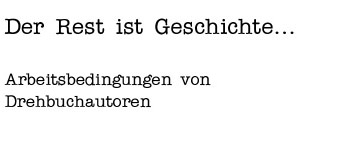 INTERVIEW
FRITZ LEHNER Kein Fest für Produzenten Als ich bei Fritz Lehner um ein
Interview anfrage, befindet er sich mitten in den Dreharbeiten zu
"Jedermanns Fest". Zweieinhalb Jahre, nachdem die letzte
Klappe zu den ersten Dreharbeiten gefallen ist. Dazwischen lag ein
Kampf zwischen Produzent und Filmautor, der nicht nur in der Branche
die Gemüter erregte. Der mittlerweile in der Regierung sitzende
Franz Morak stellte bereits 1997 zwei dringliche parlamentarische
Anfragen an den Bundeskanzler, wie nun der Bund der Fortsetzung
des Filmwerks gegenüberstünde. Die Rede war vom teuersten österreichische
Film aller Zeiten. Dabei wurde übersehen, daß von den 70 Millionen,
die der Film an Herstellungskosten erforderte, zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr als 29 Millionen aus Österreich kamen, von Seiten des
Bundes (ÖFI) nicht mehr als acht Millionen, was sich durchaus in
den normalen Förderungsgrenzen für einen Spielfilm bewegte. Dies
hinderte den damaligen FPÖ-Kultursprecher und jetzt an ganz anderer
Stelle wieder von der Bildfläche verschwundenen Michael Krüger nicht,
zu wettern, daß "diesem Mißbrauch von Steuergeldern ein Riegel
vorgeschoben werden muß." Angesichts dessen war das Vertrauen
und die Offenheit, die mir Fritz Lehner gegenüber meinem Ansinnen
nach einem Gespräch entgegenbrachte, geradezu verblüffend. Er sicherte
mir nach Ende der Dreharbeiten das Interview zu. Auffällig am Drehbuch sind einige handgemalte, schwarze Striche - Szenen, die noch zu drehen waren, wichtige und teilweise sehr aufwendige Szenen -, dann andere, die wieder gestrichen wurden. Lehner hatte, nachdem im Herbst 1996 die Dreharbeiten abgebrochen wurden, ein "Notprogramm" erstellt, das in drei Wochen Drehzeit realisiert werden hätte sollen. Der Produzent lehnte ab. Dazu sind vielleicht zwei Dinge anzumerken: Der Produzent, Veit Heiduschka von der Wega Film, zählt immer noch zu den seriösen österreichischen Filmproduzenten, und eine Weiterführung des Projekts ohne weitere Förderungen hätte die Produktionsfirma in den sicheren Konkurs geführt. Nachdem Veit Heiduschka im Juni 1998 zwei Drehtage ohne den Regisseur nachholte, klagte Lehner den Produzenten. Daß es dann doch nicht zu einem Prozeß kam, lag daran, daß die Geldgeber an den künstlerischen Erfolg des Stoffes glaubten. Einerseits war dies ein großes Glück für den Film, andererseits hätte ein Prozeß, bei dem es um den Eingriff des Produzenten in ein urheberrechtlich geschütztes Werk gegangen wäre, zumindest für Autoren eine interessante Situation ergeben: Hätte Lehner gewonnen, wäre daraus ein Präzedenzfall geworden, der die Position der Produzenten geschwächt hätte. So sind wir in Österreich, wo wir vorher waren: beim rechtlosen Autor. Zumindest sollte uns aber die Konsequenz, mit der Fritz Lehner die Realisierung seines Stoffes verfolgte, ermutigen, daß wir gegenüber Produzenten als Urheber selbstbewußt auftreten können. Im übrigen ging es in meinem Gespräch mit Fritz Lehner nur am Rande um den Streit mit dem Produzenten. Viel interessanter schien mir die disziplinierte und einzigartige Schreibmethode von Lehner. Es ist zu wünschen, daß "Jedermanns Fest" genauso emotionales Aufsehen bei seiner künstlerischen Beurteilung erregen wird wie bisher bei Plauschen zwischen Brancheninsidern. Und daß es noch lange nicht der letzte Film von Lehner bleiben wird...
INTERVIEW. MAI 1999
In welchem
Alter haben Sie sich entschieden, mit Film zu arbeiten?
Vorrangig wird immer das Bild sein. Deswegen muß man das andere nicht vernachlässigen. Wenn ich gesagt habe, daß ich mich mit Hörspielen beschäftigt habe, so war das die erste Möglichkeit, in Verbindung mit einer Technik, die etwas reproduzierbar macht, etwas zu kreieren, das jederzeit vorführbar ist. Zwangsläufig war das Wort am Anfang, ist sehr schnell ergänzt worden durch das Bild, indem ich nicht nur Hörspiele gemacht habe, sondern auch Tonbildschauen, und zwar in Verbindung mit dem damals noch wenig berührten Gebiet der Stereophonie. So wie andere Maturaklassen Theater gemacht haben, haben wir Tonbildschauen gemacht. Das Wort ist natürlich etwas, das ich sehr schätze und hoffentlich sehr pflege, aber das Um und Auf des Films ist natürlich das Bild.
Wie waren ihre Erfahrungen auf der Filmakademie? Haben Sie viele Kurzfilme gemacht? Ja, wie andere auch. Möglicherweise etwas mehr als manche meiner Kollegen, aus dem einfachen Grund, weil ich gemerkt habe, ich werde von einigen wenigen Lehrern einiges bekommen an Unterricht, werde letztendlich aber auf mich selbst gestellt sein. Ich habe auf der Filmakademie von sehr vielen Leuten nichts gelernt, und von sehr wenigen sehr viel. Immer wieder hab ich die Möglichkeit genützt, nach dem Pflichtprogramm, dem Dokumentarfilm oder was immer von Stummer und dann von Corti gefordert wurde, den sogenannten Kürfilm zu machen. Das heißt, wenn man mit dem Programm fertig war, konnte man noch Material und Geld bekommen, um einen Film freier Wahl zu machen. Und das hab ich immer genützt.
Wie sind Sie mit Corti zurechtgekommen? Insgesamt ganz gut, weil ich von ihm vieles gehört habe, was ich vorher noch nicht gehört hatte, weil er aus der Praxis kam, wobei ich auch das Gefühl hatte, daß Corti sehr sorgfältig damit umgegangen ist, was er uns mitgeteilt hat. Wir haben uns gut verstanden. Das hat sogar so weit geführt, daß ich sein zweiter Regieassistent bei "Jakob, der Letzte", einer Rosegger-Verfilmung, war. Der erste Regieassistent war übrigens Reinhard Schwabenitzky. Ich war sicher der denkbar schlechteste Regieassistent, den Corti jemals gehabt hatte. Ich hab das ständig mißverstanden und mich immer wieder damit beschäftigt, wie man etwas inszenieren könnte und dadurch versäumt, manche wirklich wichtigen Informationen zwischen Produktion und Regie weiterzugeben. Axel Corti hat das, so glaube ich, auch zu Recht bereut, allerdings ihn nicht davon abgehalten, wenn´s einen Film von mir gab, mich anzurufen und mir zu sagen, daß er ihm gefallen hätte, und – was mich als Anerkennung besonders gefreut hat –, daß er in der Zeit, wo er von seiner Krankheit wußte, mir die Regie für die Fertigstellung von "Radetzkymarsch" übertragen wollte. Ich hatte übrigens auch für zwei Semester Wojtech Jasny als Regielehrer, ein Cannes-Preisträger aus der damaligen Tschecheslowakei, das war 1972/73. Ich hab damals einen Kurzfilm in Verbindung mit ihm gemacht, ein Film mit dem Titel "Züge". Das war ein 27-Minuten-Spielfilm, der mich als Schüler des zweiten Jahrgangs schon sehr herausgefordert und beschäftigt hat. Und dann gab es noch Stummer, mit dem ich eine Fülle interessanter Gespräche hatte, die über das Regiehandwerk hinausgingen. Da ging es um philosophische Themen oder um grundsätzliche Themen der Lebensgestaltung, Lebenshaltung, Moral und tausend andere Dinge. Auch das hat mich sicher geprägt.
Regie haben Sie abgeschlossen, Drehbuch nicht. Ich hätte nur mehr ein langes Drehbuch schreiben und die Diplomarbeit machen müssen, aber es hat dann keinen Sinn für mich ergeben. Es war eine Situation, in der mir Zusanek seine Art des Drehbuchschreibens doch immer mehr nahebringen wollte und meine Tendenzen und Absichten unter Umständen ein wenig verkümmert wären. Ich wollte nicht ein kleiner Zusanek werden. Wir sind aber ohne jede Konfliktsituation auseinandergegangen, sondern mit großer Wertschätzung.
Nach der Filmakademie haben Sie relativ bald Fernsehfilme gemacht Eigentlich unmittelbar danach und zwar hab ich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Kurzfilme, die ich auf der Filmakademie gemacht habe, Leuten zu zeigen, die in der Branche tätig waren, speziell Redakteuren. Teilweise war es auch gar nicht notwendig, weil es damals die Sendung "Aus der Werkstätte der Filmakademie" gab, später hieß es "Metternichgasse 12", in der Filme von Studenten im Fernsehen gelaufen sind. Ich habe dadurch Zugang zu Leuten bekommen, die in der Branche als Produzenten oder Redakteure tätig waren. Durch die Vermittlung eines Schauspielers, Rudolf Jusits, habe ich Hans Preiner kennengelernt, der lange Jahre beim ORF eine Sendereihe geleitet hat, die vergleichbar mit den "Kunststücken" war. Damals gab es ein Projekt: die Verfilmung eines Kapitels des Romans "Der große Horizont" von Gerhard Roth. Das ist dann ein Jahr lang herumgetragen worden, es kam aus verschiedenen Gründen nicht dazu und dann hat man mir das angeboten. Das war ein kleiner Spielfilm, allerdings mit der Bereicherung, daß er zur Gänze in New York gedreht worden ist. Das heißt, unmittelbar nach der Filmakademie hab ich diese Geschichte mit einem kleinen, großteils amerikanischen Team in New York gedreht und das war mein erster Film fürs Fernsehen.
Nein, es war der Roman als Vorlage da und ich habe das Drehbuch dazu geschrieben.
So war es ja später auch bei "Schöne Tage"? Ja, auch nach dem Roman das Drehbuch geschrieben.
Relativ viele Literaturbearbeitungen? Das hat sich damals ergeben durch die Neigungen der Fernsehredaktionen, speziell der Abteilung "Fernsehspiel". Das waren Wolfgang Ainberger, der maßgeblichst hier aktiv war, Werner Swossil, Gerald Szyskowitz. Diese drei Leute haben immer gewissen Wert auf Literaturverfilmungen gelegt und so bin ich auch dazu gekommen. Sowohl bei diesem Gerhard Roth-Film, den mir noch deren Vorgänger angeboten haben, zu denen eben Hans Preiner und bereits Wolfgang Lorenz gehört haben.
Wie gestaltet sich die Arbeit am Drehbuch nach einer literarischen Vorlage, zum Beispiel bei "Schöne Tage"? Ich habe Innerhofers Roman sehr oft gelesen, sodaß ich ihn fast auswendig konnte. Und dann habe ich ihn zur Seite gelegt, und zwar für immer. Dann habe ich mit diesem, im Kopf existierenden Roman das Drehbuch geschrieben, mit dem Prinzip, daß Literaturverfilmung für mich nie gelungen ist, wenn sie sich buchstäblich an die Vorlage hält. Wenn man sich jetzt an das hält, was im Roman steht, auch bezogen auf die Dialoge, wird es grauenhaft und furchtbar. Letztendlich kam dann ein Drehbuch raus, das auch von Innerhofer akzeptiert wurde, in dem ungefähr ein Drittel der Szenen neu waren, die mit meiner eigenen Erfahrung und Recherche zu tun hatten, und in dem trotzdem 70% dessen, was im Drehbuch stand, seine Szenen waren. Manche etwas umgestaltet, verdichtet, auch im Ablauf anders, anders gewichtet, dem Film gehörend. Es wäre viel weniger Arbeit, einen Roman gekürzt als Drehbuch abzuschreiben, als das ganze zu verinnerlichen, wie es aber immer notwendig ist, wenn’s ein fremder Stoff ist, oder wenn man fotografiert, komponiert oder Theaterstücke schreibt. Ein eigener Stoff kommt sowieso aus dem Inneren, da braucht man sich keine Sorgen zu machen.
"Schöne Tage" wurde ausschließlich mit Laien gedreht? Ja. In "Schöne Tage" gab es 50 Sprechrollen, die ausnahmslos mit Laien besetzt waren. Sehr zum Schrecken des Co-Partners Sender Freies Berlin, der gemeint hat, jetzt investieren wir so viel Geld und dann wird mit Laien gedreht. Ich konnte mir bei "Schöne Tage" einfach nicht vorstellen, Bauern mit Schauspielern zu besetzen. Das hab ich nie oder ganz selten wirkungsvoll und glaubwürdig gesehen. Für mich ist Bauer ein Stand, und nicht nur irgendein Beruf, so wie König auch etwas besonderes ist.
Wenn Sie wissen, daß Sie mit Laien drehen, ändert das auch das Schreiben? Überhaupt nicht. Ich hab da nie Rücksicht genommen, ganz im Gegenteil. Genauso wie ich mir nie nur einen bestimmten Schauspieler vorstelle. Wenn ich diesen Schauspieler schon einmal im Kopf hätte, dann würde ich unwillkürlich Situationen und Szenen so schreiben wie ich sie ihm zutraue. Dadurch versäume ich aber eine ganze Menge, denn der Schauspieler hat bisher nur das gezeigt, was er zeigen konnte und kann möglicherweise noch unvergleichlich mehr zeigen. Das heißt, ich verbanne beim Schreiben die Besetzung vollkommen aus meinem Bewußtsein. Genauso nehme ich nicht die geringste Rücksicht, daß eine Rolle zwangsläufig von einem Laien gespielt wird.
Haben Sie gegenüber den Redakteuren beim Drehbuch freie Hand gehabt oder wollten die Einfluß auf die Bücher nehmen? Immer freie Hand. Ich weiß nicht, warum man sie mir gelassen hat, vielleicht weil ich nie irgendjemanden die Möglichkeit geboten habe, sich einzumischen. Es gab Hinweise, Empfehlungen, Ratschläge, gute und weniger gute Gespräche. Es gab mit Wolfgang Ainberger und Werner Swossil interessante Auseinandersetzungen und Diskussionen. Das waren in meiner Erinnerung die einzigen, die sich auch die Mühe gemacht haben, sich mit den Büchern entsprechend zu beschäftigen. Aber es gab kein einziges Mal Druck, wo es geheißen hat, das müßte man ändern. Es gab zwei oder drei hilflose und höchst untaugliche Versuche, einmal von einem deutschen Redakteur, die eher ins Leere gelaufen sind. Ich mußte nie auch nur eine Zeile ändern, es ist mir auch nie die Situation untergekommen, wo ich unter Druck stand. Unter Druck stand ich immer wieder in Verbindung mit der Tatsache, daß meine Drehbücher immer länger waren als gefordert, die Schnittzeit, die man beim Drehen ermittelt hat, zwangsläufig auch immer länger war, noch länger als die noch längeren Drehbücher, und daß man gesagt hat, jetzt haben wir eh schon so viel Material, brauchen wir das noch? Und dann wurde bei "Schubert" einiges an Druck auf mich ausgeübt, und der denkbar größte jetzt bei "Jedermanns Fest", der eine 2 ½ jährige extreme Konfliktsituation zwischen Produktion und mir zur Folge hatte, die bis zum Prozeß gegangen ist. Letztendlich haben wir das gedreht, was im Drehbuch steht. Uneingeschränkt.
Selten.
Das ist heute ein großes Problem. Ja, finde ich schade. Alles wird genormt nach einer Sprache, von der man meint, sie müßte wirklich deutsch sein. Das Deutsche, das in Deutschland gesprochen wird, ist ja voller Fehler, ist voll Unbeholfenheiten, gehört zum Dümmsten überhaupt, wie man Deutsch sprechen kann. Man geht nicht hoch, man geht auch nicht tief, man geht hinauf oder hinunter. Und wenn sich dann liebe Kollegen aus Österreich dadurch beliebt machen wollen, indem sie diesen deutschen Schwachsinn in österreichische Drehbücher schreiben, dann mögen diese Leute früher oder später einmal draufkommen, daß sie da einem nicht sehr geistreichen Herrn gedient haben.
Diese ersten Fernsehfilme sind relativ schnell gemacht worden. Dann sind die Pausen zwischen den Filmen immer länger geworden... Die Pausen wurden etwas länger, weil die Projekte größer wurden. Ich habe zwischen 1976 und 1983 einen Film nach dem anderen gemacht. Nach "Der große Horizont" kam ein einstündiger Filmessay über meine Heimatstadt Freistadt, dann kam mein erster 90-Minuten-Spielfilm fürs Fernsehen, "Edwards Film", weiters ein Film mit dem Titel "Der Jagdgast", nach einem Originaldrehbuch von Gernot Wolfgruber. Dann in verschiedener Abfolge die Pluch-Verfilmungen, "Das Dorf an der Grenze", "Schöne Tage" (1980) und dann die etwas längere und umfangreichere Arbeit an den drei Teilen Schubert. Nach "Schubert" hatte ich – wie Sie zu Recht sagen - eine ganz lange Distanz, 13 Jahre, bis ich wieder gedreht habe. Eine Zeit, die fast ausschließlich mit Drehbuchschreiben ausgefüllt war. Ich habe ich mich umfassend mit einem Stoff aus der Monarchie beschäftigt, und zwar der Payer-Weyprecht– Expedition, die zum Nordpol führen sollte, dort aber nie angekommen ist. Dann hab ich mich viereinhalb Jahre in Verbindung mit einem Auftrag durch einen amerikanischen Produzenten uneingeschränkt mit Friedrich dem Großen beschäftigt, d.h. zwei Jahre lang Drehbuch geschrieben und zweieinhalb Jahre vorbereitet. Das wäre eine sehr kostenaufwendige Produktion, die noch nicht finanziert ist, und alles überschreitet, was bisher im deutschen Sprachraum oder speziell in Europa realisiert worden ist. Das braucht eben seine Zeit und hat mir dadurch auch die Gelegenheit genommen, bestimmten Projekten, die man mir angeboten hat, zuzusagen. Ich bin weit davon entfernt, ein Drehbuchautor zu sein, der schreibt und darauf giert, endlich drehen zu können, sondern der sich beim Schreiben unglaublich wohlfühlt. Meine größten Glückszustände finden beim Schreiben statt, weil man da am meisten kreieren kann.
Wann ist ein Drehbuch fertig für Sie? Wieviele Fassungen haben Sie durchschnittlich gebraucht? Nicht so viele. In der Regel habe ich nach der Fassung, die ich abgebe eine oder höchstens eine zweite Überarbeitung gemacht. Das hat damit zu tun, daß ich mich so lange mit dem Drehbuch beschäftige, bevor ich’s abgebe (und das schon in der Zeit, die vertraglich vereinbart ist), daß ich sagen kann, okay, das ist es. Ich halte nichts davon, jede Menge Fassungen zu schreiben, hab allerdings im Hinblick auf Friedrich, in Zusammenarbeit mit diesem amerikanischen Produzenten, an die acht oder neun Fassungen verfasst. Hier ging es aber darum, von einem ursprünglich 330seitigen Drehbuch auf 150, 160 Seiten zu kommen. Das waren Verkürzungs- oder Verdichtungsarbeiten. Sonst möchte ich schon die Erstfassung als Vorstufe zur sogenannten "Bibel" sehen. Das heißt, nachdem ich die Reaktionen der Leute habe, überarbeite ich das ganze, und das, was dann rauskommt, ist auch das, was für alle verpflichtend ist. Auch für mich.
Wie lange dauert bei Ihren Filmen die Arbeit am Drehbuch? Meinen ersten 90 Minuten-Spielfilm,
"Edwards Film", hab ich in 22 Tagen oder etwa einem Monat
geschrieben, für "Schöne Tage" hab ich vier oder fünf
Monate gebraucht, für die drei Teile "Schubert" elf Monate,
für "Jedermanns Fest" acht Monate, für die Konzeption
bis zum 200-Seiten-Treatment für die Monarchie-Expedition zum Nordpol,
habe ich - glaube ich - elf Monate gebraucht, für "Der Baum"
- das sind fast fünf oder sechs Stunden Film - ein Jahr oder noch
länger, für "Friedrich" zwei Jahre.
Welche Hilfsmittel gibt's da? Ich kann das nur verknappt formulieren, weil um das zu beschreiben, könnte ich ein Jahr drüber reden. Im Prinzip hat es im weitesten Sinn mit dem, auch von manchen Romanautoren benützten Zettelkasten zu tun. Das heißt, ich nütze die Tatsache, daß Film aus vielen kleinen Elementen - Steinchen eines Mosaiks - besteht, um beim Schreiben Karteikarten zu verwenden, wobei ich bei "Schubert" 600 Karteikarten hatte, bei der "Nordpol"-Geschichte 2000, bei "Jedermanns Fest" 3000, beim Baum waren’s 5000, und bei "Friedrich" waren es 10000 Karteikarten.
Da steht alles drauf, was irgendwann einmal im Film vorkommt.
Alles, was man sieht, was man hört, ... ... was filmisch darstellbar ist. Auch solche Dinge, die man nicht dem Bild oder Ton zuordnet, sondern wo’s um Atmosphäre geht, um das Zwischenreich, das für mich das Entscheidendste ist. Das ist meine Arbeitsmethode, entspricht auch meinem Ordnungssinn. Ich glaube, Film funktioniert dann am besten, wenn das Chaos geordnet wird, aber immer wieder das Chaos provoziert, zugelassen oder auch evoziert wird. Auch beim Drehen macht es mir ganz große Freude, am Drehtag selbst noch etwas umzustoßen und anders zu machen.
Daß man sich selber überraschen kann? Selbstverständlich. Vor allem die Produktion (lacht)
Beim Drehen halten Sie sich aber recht genau an das Drehbuch? Nicht ganz genau, aber ziemlich. Weil ich davon ausgehe, daß es von mir einmal richtig gedacht war und ich es oft genug überprüft habe. Aber ich modifiziere schon. Im Bereich von etwa 20 Prozent. Und zwar dann, wenn ein Schauplatz, oder ein Schauspieler, oder eine Situation bessere Möglichkeiten anbieten. Ich glaube, Voltaire hat gesagt, "das Bessere ist der Feind des Guten". Und alles, was noch so gut war, wird dann gnadenlos gekillt.
Wie ist es bei tausenden Karteikarten möglich, den Überblick zu bewahren? Haben Sie ein Ordnungssystem? Das Ordnungssystem par excellence ist der Filmablauf. Das ist, wie wenn Sie eine Cutterin fragen, wie es im Schneideraum möglich ist, den Überblick zu bewahren. Das ist auch die Kombination von einem Logbuch, von einem Skript, vom Drehbuch, von hunderten Dosen von vorhandenem Material, Ausschnitten, Resten, einem Rohschnitt, und dem, was im Kopf der Cutterin gespeichert ist. Und ich kann schon behaupten, alles gespeichert zu haben. Was nicht gespeichert ist, ist auf der Karteikarte vorhanden, und die nehme ich durch meine Arbeitsmethode zwangsläufig so oft in die Hand, daß sie mehr und mehr auf der Festplatte in meinem Gehirn gespeichert wird. Es hat auch damit zu tun, daß ich mich in die Situation versetze, meine Geschichte und meinen Stoff mit den Verzweigungen –mir ist ja das Komplexe lieber als das Lineare –, mehr und mehr vollkommen intus habe. Ich muß es lernen.
Im Gegensatz zu den Literaturverfilmungen ist "Jedermanns Fest" ein fiktiver Stoff, der von Ihnen selbst gekommen ist. Wie ist der Stoff überhaupt entstanden? Vorweg muß ich einmal sagen, daß "Der Baum", eine meiner umfangreichsten Geschichten nach "Friedrich", auch fiktiv war. Da geht’s um einen Baum in einer Landschaft, daneben ist ein kleiner Teich und eine kleine Kirche. Dort spielen vier Jahrhunderte. Ein Baum, der ein längeres Leben als wir hat, und vieles in diesem Leben gesehen hat, gibt also einen phantastischen Schauplatz ab. Da war alles fiktiv, alles erfunden. Genauso ist bei "Jedermanns Fest" wirklich alles erfunden, allerdings mit der Vorgabe, daß es diesen "Jedermann"-Stoff nun einmal gibt. Die Idee, die eine einfache war, entstand in einem Lokal um zwei Uhr früh. Ich hab mir überlegt, warum mach ich immer Drehbücher und Filme über Leute, die mich faszinieren und interessieren, warum mache ich nicht etwas, das mir sperriger vorkommt. Und ich dachte nach: was interessiert mich überhaupt nicht? Die Lippizzaner interessieren mich überhaupt nicht. Was noch? "Jedermann" interessiert mich nicht. Und dann hab ich mir gedacht, warum eigentlich. Nur weil’s der Salzburger "Jedermann" ist, wegen dem Getue um die Buhlschaft, und das ganze Gekrächze um diese Veranstaltung, die touristisch geworden ist und mit dem Ereignis nichts mehr zu tun hat. Warum mache ich da keinen Film? Das war die eine Überlegung. Die zweite, warum ich nicht, im Gegensatz zum Domplatz in Salzburg, wo die Distanz vom Zuschauer zur Festtafel eine sehr große ist, die Möglichkeit der Kamera nütze, um den Zuschauer direkt an die Tafel zu setzen. Das heißt, den Figuren ganz nah zu sein, manchen näher zu sein, als es der Gastgeber ist. Diese beiden Überlegungen waren am Anfang, und dann habe ich mich mit dem Stoff beschäftigt. Hofmannsthal hat für Salzburg aus fünf verschiedenen Vorlagen seinen "Jedermann" geschrieben, sich am Anfang auch nur als Chronist bezeichnet, da er selbst wenig eigenes eingebracht hat. Später, wie der Erfolg groß geworden ist, hat er schon gemeint, er sei auch der Dichter. "Jedermann" kommt aus dem Mittelalter, da gibt es Quellen aus Sizilien, aus England mit dem ersten festgehaltenen "Everyman". Es gibt weit über 100 Jedermann-Theaterstücke, mit verschiedenen Interpretationen. Und immer wurde Jedermann als Spiegel der Zeit betrachtet. Dadurch hat mich die Sache interessiert: Wie geht heute jemand damit um, wenn er erfährt, daß er in drei Stunden tot ist? Das war die Ausgangssituation und für alles andere habe ich mir gestattet, es frei zu betrachten. Zwangsläufig sollte es schon in der Gegenwart spielen, wenn es eine Spiegelfunktion für unsere Zeit haben sollte, und so war die Idee ganz nebulos: ein erfolgreicher, reicher Mann wird konfrontiert mit seinem eigenen Tod in Verbindung mit einem Fest, das zu seinem Abschiedsfest wird. Das ist noch die große Parallele zum "Jedermann"-Stoff im allgemeinen. Das habe ich verschiedenen Leuten angeboten, damals noch dem Szyskowitz vom ORF, dann Volker Schlöndorff von den Babelsberg-Studios und noch Ainberger vom Wiener Filmförderungsfonds, und da gab’s großes Interesse und so ist es zustande gekommen. Dann hab ich mich zwangsläufig mit der historischen Basis des Stoffes beschäftigt und einige Jedermann-Stücke gelesen, auch den Salzburger "Jedermann", von manchen Inspirationen bekommen, von manchen nicht. Ich wollte einiges an Elementen beibehalten, nämlich, gibt’s eine Vergebung, gibt’s eine Katharsis, gibt’s eine Beichte oder gibt’s eine Läuterung oder nicht, usw. Mein Jedermann hat keine Läuterung, keine Katharsis, der stirbt so, wie er gelebt hat, er macht aus seinem Tod noch ein Geschäft. Das war die Absicht und so ist die Entscheidung für das Milieu der Modebranche sehr schnell gekommen. Kaum sonstwo haben Krankheit, Alter oder Tod so wenig Platz wie in der Modebranche. Es hätte aber auch in der Fernsehwelt spielen können oder Jedermann hätte ein Schönheitschirurg sein können. Es ist auch kein Film über Mode, es ist nur das Milieu, in dem sich Jedermann mehr oder weniger erfolgreich entfaltet.
Kennen Sie dieses Milieu? Ich hab’s kennengelernt durch meine Recherchen.
Sind Sie da zu Veranstaltungen gegangen? Jaja. Es gibt auch jede Menge Dokumentationen, auf Video gibt es unzählige Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Zum Teil mit Vergnügen, zum Teil mit Langeweile, weil es auch etwas extrem Oberflächliches ist, aber dahinter stecken zwangsläufig Menschen, und die sind wieder interessant. Aber auch die Modebranche ist interessant. Wenn man da Zusammenhänge herstellen kann oder begreift, daß zum Beispiel diese Shows ja überhaupt nicht mehr den Zweck haben, bestimmte Kreationen an gut situierte Leute anzubringen. Da gibt es Kleider, die kosten 200.000 oder 300.000 Schilling. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wo die Show stattfindet, wie spekakulär dieser Schauplatz ist und welche Mädels diese Fetzen tragen. Das wird enstprechend oft publiziert und dann wird halt immer wieder der Name damit verbunden: ob das Armani ist, oder dieser und jener. Das heißt, es kommt darauf an, dem Namen ein bestimmtes Image zu geben, ihn wie eine Gottheit hochzuhalten und zu beweihräuchern. Dieser Vorgang dient letztendlich einem Zweck: daß in Fernost gigantische Unternehmen damit beschäftigt sind, Massenware zu erzeugen, auf die dann Armani oder irgendwas draufkommt, und das Zeugs hängt dann in den riesigen Kaufhäusern in der ganzen Welt, und wird dort, weil Armani draufsteht, gekauft. Das ist die Industrie. Die Kreationen der einzelnen sind vollkommen sekundär. Das sind interessante Dinge. Und auch die totale Ausklammerung des Alters. Allein in meiner Zeit des Schreibens, Vorbereitens und Drehens, der Prozeßsituation und des Weiterdrehens, sind die Models auf den Laufstegen immer jünger geworden. Am Anfang waren die Models so 21,22, beim Vorbereiten des Films waren sie 18, inzwischen sind sie 16 und 14.
Nein, das ist immer archetypisch. Bei allen Figuren. Nicht bezogen auf die Jahrhunderte – sondern das, was Menschsein überhaupt ausmacht. Wie verhält sich jemand, wenn es gut geht, wie gestört fühlt er sich, wenn’s ihm nicht mehr gut geht. Wie stirbt jemand?... Wenn man die Gelegenheit hat, den eigenen Tod zu erleben, was ja nicht sehr wünschenswert ist, zumindest glaubt das unsere Gesellschaft, dann stirbt man so, wie man gelebt hat. Also entweder wird man damit fertig und bewältigt es oder man verzweifelt daran. So wie man im Leben ja auch mit den Dingen fertig wird oder auch nicht. Es steht für überhaupt keine Figur eine Person, die mir in der Realität bekannt wäre. Alle Models, die im Film vorkommen, sind bewußt ohne Eigencharakter. Das sind sozusagen die Blumen, mit denen sich Jedermann umgibt.
In ihrem Drehbuch verstehen sich die Models selbst nur als Produkte? Manche schon, die durchauen’s nicht. So wie in allen Bereichen. Natürlich hat mich die Eiseskälte interessiert, mit der einem Erfolg nachgegangen wird. Zum Beispiel bei dieser 16jährigen Cocaine, die nur ein Ziel hat: mit ihrer Schönheit und Ausstrahlung und der Wirkung auf Männer etwas zu erreichen. Das trifft man heute immer wieder an. So, wie der Tod in der Gesellschaft nie so sehr verdrängt geworden ist wie heute, ist auch das Streben nach Erfolg heute größer als jemals zuvor. Nämlich als Norm. Leute machen sich todunglücklich, weil sie glauben, sie müssen erfolgreich sein. Sie beziehen ihren Wert nur aus dem täglichen Erfolg und Tun, und nicht mehr aus der eigenen Persönlichkeit. Für mein Gefühl sind das schlimme Entwicklungen.
Die erste ist, Jedermann verunglückt mit dem Ferrari, und in den Sekunden des Sterbens erlebt er das, was der Zuschauer auch im Film sieht. Die zweite Möglichkeit ist, er stürzt in diesen Teich bei der Raffinerie und in den Stunden des Sterbens, das sind 24 Stunden oder noch länger, erlebt er das, was der Zuschauer im ganzen Film sieht, das Fest, usw. In der dritten Möglichkeit, der "metaphysischen", vereinbart er mit seinem Tod, das ist der Hund am Teich, daß er diese Nacht noch zum Fest darf und am Morgen zurückkommt, um den Tod einzulösen. Die vierte Möglichkeit: alles, was für den Zuschauer vor dem Unfall im Teich sichtbar war, ist nichts anderes als der vorhergesehene Selbstmord. Und zwar angesichts der Tatsache, daß er durch seine Show, die der großen Modeschöpferin Yvonne Becker nicht gefallen hat, als König gestürzt ist und keine Bedeutung mehr hat. Meine Intention war es, daß alle diese vier Möglichkeiten dramaturgisch funktionieren müssen. Ich kann wirklich alles daraufhin überprüfen. Der Zuschauer, der ja durch ein bestimmtes Leben geprägt ist, Neigungen und Sehweisen hat, wird sich für eine dieser vier Möglichkeiten entscheiden. Oder auch mischen, zumindest beim Film.
Wann haben Sie eigentlich den Schluß gehabt? Ich hab etwa acht Monate für das Drehbuch gebraucht, also werde ich ihn innerhalb der ersten zwei, drei Monate gehabt haben. Der Schluß ist für mich immer sehr entscheidend. Der Schluß ist ganz entscheidend. Es ist schrecklich, wenn ein Film abstürzt, der davor vieles verspricht und dann nicht einhalten kann. Es muß deswegen nicht jeder Schluß allen Zuschauern gefallen, es kann auch Ärger geben oder Ablehnung, das ist was anderes. Nur glaube ich, man soll sich mit dem Schluß mehr beschäftigen und eben nicht in Hinblick auf Erschöpfung kreieren. Das heißt, am Anfang alles und alles und alles und dann stürzt die Linie ab. Ich bin dafür, sich mit dem letzten Drittel eines Films sehr zu beschäftigen.
Wenn Sie schreiben, wie schreiben Sie? Wie lange zum Beispiel?
Was machen Sie am Vormittag? Na ja, ich geh meistens um vier oder fünf Uhr in der Früh ins Bett, also gehört noch ein Teil des Vormittags dem Schlaf, und dann nach dem Aufwachen, dem Sich-Ordnen und Zurechtfinden und Vorbereiten auf die Arbeit, ist ungefähr 14 Uhr der Beginn. Ich kann nicht sagen, wie lang ich arbeiten werde, deswegen, weil ich nicht sage, so und so viel Stunden muß ich arbeiten, sondern ich muß an diesem Tag an die 30 Karteikarten oder sechs Drehbuchseiten geschrieben haben. Bei "Jedermann" war das zum Beispiel so.
Das ist eine disziplinarische Vorgabe? Ja, egal, wie lange ich brauche. Wenn ich das in zwei Stunden geschafft habe, habe ich frei. Und wenn ich’s in acht Stunden nicht geschafft habe, bleibe ich so lange sitzen, bis ich’s schaffe, ... und wenn ich 14 Stunden dabei sitze. Das ist vollkommen unabhängig. Ich hab keine Tage, wo ich sage, heute ist die Muse nicht bereit, mich zu küssen, drum mache ich blau. Es kommen auch Tage vor, an denen wirklich nichts zustande kommt, allerdings meistens mit dem Resultat, daß am nächsten Tag ein Doppeltes an Ergebnis rausschaut. Und es gibt auch Situationen, in denen mir in sieben, acht Stunden nichts einfällt, und in der neunten Stunde alles passiert.
Sind während der Arbeit auch Selbstzweifel vorhanden? Nicht sehr ausgeprägt. Was immer wieder vorkommt, ist der Gedanke, wie gut der Tag davor war beim Schreiben. Ich bin dann unruhig, ob ich’s heute wieder schaffe. So als würde einen die Potenz wieder verlassen können. Damit rechne ich jeden Tag. Das heißt, ich kann einen Stoff noch so gut vorbereitet haben, es kann trotzdem dazu kommen, daß ich es nicht schaffe, ihn zu Papier zu bringen. Wenn mich etwa die Fähigkeit verläßt, Sätze zu formulieren oder Bilder zu beschreiben. Wenn ich sehr viel gearbeitet habe, kann es sein, daß ich sehr blockiert bin, daß ich mich im Kreis drehe. Das heißt also, ich bin wahnsinnig angespannt vor Arbeitsbeginn, nicht zugänglich, aggressiv. Ich schließ mich dann vollkommen ab und rechne halt damit, daß dieser Tag daneben gehen kann. Von 40 Arbeitstagen geht einer daneben, also bewege ich mich in dem Bereich von 2,5 Prozent. Die anderen gelingen, nur diese 2,5 Prozent des Mißlingens genügen mir, jeden Tag das Gefühl zu haben, heute könnte einer sein, der daneben geht. Das erzeugt auch eine gewisse Spannung, die mir sehr hilft. Ich verwende natürlich sehr stark das Rituelle, von Kaffee und Teetrinken bis Zigarettenrauchen in bestimmter Abfolge, Schreiben von Karteikarten mit einem bestimmten Füller, etc. Oft denke ich zehn Minuten vor dem Schreiben, heute kann ich nicht. Dann unternehme ich vor 14 Uhr eine Fülle von Fluchtversuchen. Der Herr in mir ist aber so streng, daß der Knecht in mir immer gehorcht. Die Fluchtversuche entstehen gar nicht so richtig, und dann fang ich halt an, den Computer zu starten, die Datei aufzumachen, den ersten Satz zu schreiben, und wenn ich das gemacht hab, ist der Bann gebrochen. Wie der Schauspieler auf der Bühne. Vorher hat er Lampenfieber, dann geht er raus, sagt den ersten Satz und es läuft. Und dabei hilft mir schon eine Fülle von banalen Dingen, das eigenartige Klappern der Tastatur, deren angenehmes Gefühl auf den Fingern ...
Ja, natürlich, das macht sehr viel aus. Und auch der Füller. Oder auch, wann ich eine Zigarette anzünde und wie ich sie anzünde. Ich schließ mich auch beim Schreiben und Arbeiten vollkommen ab, das heißt ...
... keine Anrufe? Nichts, nichts. Vollkommen undenkbar. Ich ziehe auch im Sommer Rollos vor, verwende zum Teil Ohropax. Ich blende die Umwelt vollkommen weg, damit ich zu meinen Figuren und meiner Geschichte komme. Ich arbeite auch verschieden mit Musik (wo ich übrigens kein Ohropax verwende), ich hab da einige Methoden entwickelt, vor allem in den Phasen des Ideensuchens und –findens.
Beim Schreiben selber nicht?
Es gibt Autoren, die stimulieren sich durch Alkohol oder andere Drogen ... Ich überhaupt nicht.
Ich hab es ein-, zweimal versucht vor 25 Jahren und dann Dinge geschrieben,
die mir beim Schreiben sehr gut gefallen haben und im nachhinein
unerträglich waren. Was ich manchmal mache, in Verbindung mit In-der-Nacht-unterwegs-sein
und etwas trinken, ist das Notieren von Ideen. Das kommt schon vor.
Aber die Ideen, bei denen ich schon etwas mehr getrunken habe, werden
letztendlich immer banaler. Also beim Schreiben nicht einen Schluck,
auch beim Drehen nicht. Nach dem Drehen, wenn ich weiß, am nächsten
Tag ist drehfrei, dann trinke ich ganz gern etwas. Aber kein Schluck
während des Drehens. Ich verlier die Kontrolle in dem Maß, wie ich
sie brauche. Die Kontrolle beim Schreiben muß eine extrem hochkonzentrierte
sein. Was Ideen und Rhythmus betrifft. Alles, was alkoholisiert,
hilft im Augenblick und macht Mittelmaß zu etwas Besonderem, und
das hält dann nicht stand.
Es ist beides. Ich glaube, Drehbuchschreiben ist einer der aufregendsten Berufe schlechthin, und sicherlich der Beruf des nächsten Jahrtausends bezogen auf das, was man literarisch festhalten kann. Was Jahrtausende hindurch die Theaterautoren und Dichter waren, werden – mehr oder weniger – die Drehbuchautoren sein. Ich habe ja auch schon vor der Akademie Drehbücher geschrieben, und das ist eine Sache, für die ich mindestens zehn Jahre gebraucht habe, um sie wenigstens einigermaßen zu begreifen. Ich denke, daß ich 15 Jahre immer wieder Drehbücher geschrieben habe, um mehr und mehr draufzukommen, zu erfahren und zu begreifen. Für mich ist Drehbuchschreiben eine Symbiose aus Theorie, die wirklich verewigt sein muß und aus dem Instinktiven, dem Befinden, dem Suchen, dem Sich-Aufmachen-Können, dem Empfinden, dem Erkämpfen und Abtrotzen. So lang man von Dramaturgie nur theoretisch lernt, hat es keinerlei Wert. Es muß einem in Fleisch und Blut übergegangen sein, sodaß man die Anwendung nicht mehr intellektuell darstellt.
Es gibt Leute, die vertreten die Meinung, daß man, wenn man zu viel über Dramaturgie weiß, es immer schwieriger wird, Geschichten zu schreiben. Das kann sein. Ich bin anderer Meinung.
Es sei deshalb schwieriger, weil man immer kritischer wird. Na, umso besser. Dann kommen vielleicht bessere Drehbücher raus. Das Unkritische ist eh der Fluch unserer Zeit, daß das Mittelmaß also Bestand hat. Ich glaub, man kann, ganz gleich über welchen Beruf, ob das Malerei ist oder Drehbuchschreiben oder tausend andere Bereiche, der des Schusters, oder des Kochs, über das, was an Möglichkeiten besteht, nie genug wissen. Weil man ja nicht alles benützt. Wenn ich noch mehr weiß über Dramaturgie, fallen mir erstens noch mehr Geschichten ein, die sich dadurch eröffnen, und ich kann das, was ich an Geschichten erzählen möchte, besser erzählen. Aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig, daß man sich an diese Regeln nicht sklavisch hält, sondern sie andauernd bricht. Nicht aus Trotz bricht, sondern um weiterzukommen. Die Musik des 17. oder 18. Jahrhunderts zum Beispiel, die sich an bestimmte Regeln gehalten hatte, war eine grandiose, hätte sich aber nicht weiterentwickelt, wären diese Regeln nicht immer wieder gebrochen worden. Bis hin zur Barockmusik, Musik des Biedermeiers oder Zwölftonmusik. Das ist immer wieder notwendig. Film ist nur zu einem kleinen Bruchteil erkannt. Kurosawa hat – ich glaube bei der Oscar-Verleihung für sein Lebenswerk - gesagt, er ist immer noch ein Lernender. Und er versteht so vieles von Film nicht. Und da hat er recht. Einer der ganz großen Meister, der wirklich souverän mit dem Medium umgeht, weiß natürlich, daß erst ein Bruchteil des ganzen angenagt ist. Insgesamt tritt Film jämmerlich auf der Stelle, indem nur das Handwerkliche begriffen und angewandt wird. Das Suchen nach neuen Ufern wird total vernachlässigt. Vor 25 Jahren war im italienischen, französischen, englischen Film noch viel mehr Intention, formal und inhaltlich immer wieder neue Bereiche zu erschließen. Das kommt heute rudimentär immer noch vor, aber nicht in dem Ausmaß, wie’s einmal war. Weil die Industrie eben zu mächtig ist und alles, was von der Norm abweicht, ein Störfaktor ist.
Haben Sie das Gefühl, Drehbuchschreiben ist eine Form der Literatur? Es ist möglicherweise eine Form der Literatur, was auch nicht immer gut ist. Ich halte es eher für problematisch. Andererseits benütze ich auch das sogenannte Literarische fürs Drehbuchschreiben, um den Mitarbeitern möglichst plastisch vorzuführen, was gedreht werden wird, damit sie daraufhin eigene Ideen entwickeln und darauf aufbauen können. Ich glaube, je anschaulicher ein Drehbuch ist, und dazu dient halt auch das Mittel des Literarischen mit seiner oft sehr einfachen, oft banalen, plakativen und pathetischen Sprache, umso mehr können die Leute, nachdem sie sich nach dem Lesen das Grundsätzliche vorstellen können, eigene Dingen einbringen, weiterentwickeln und darauf aufbauen.
Was glauben Sie, wieviele Leute Drehbücher lesen können? Die allerwenigsten. Das ist das größte Problem. Von jenen, die es professionell tun müßten, würde ich zwei, drei aus meinem Bekanntenkreis nennen. Produzenten traue ich nicht zu, daß sie nur einen Bruchteil der Vorstellungskraft haben, um zu erkennen, was in einem Drehbuch angedeutet wird. Das ist das größte Problem der nicht-verfilmten Drehbücher, daß ein Drehbuch nur so gut ist wie der Leser, der es in Bilder umzusetzen imstande ist. Und daran scheitert es. Am leichtesten lesen die reihenweis vorhandenen Dummköpfe in der Branche jene Drehbücher, die sie schon von irgendwoher kennen. Das heißt, die genormten. Und so werden sie auch geschrieben. Das heißt, ein Film, der die Geschichte nach dem Strickmuster "zwei glatt, zwei verkehrt" erzählt, wird es unvergleichlich leichter haben, realisiert zu werden.
Gibt es Genres, die Sie noch nicht versucht haben...? Ja, jede Menge...
... und die Sie reizen? Zum Beispiel Komödien? Na ja, darum bemühen sich ja eh jede Menge Kollegen. Reizt mich am wenigsten, weil da ein Überangebot besteht. Ich glaub zwar, daß "Friedrich" in manchen Teilen komödiantisch ist, aber eine Komödie reizt mich nicht, weil sich die Leute rundum die Beine ausreißen, nur damit sie lustig sind und viele Zuschauer haben. Der ganze deutsche Film ist voll von Komödien, bei denen es mir ganz selten gelingt, auch zu lachen, obwohl das unter Umständen deren Zweck wäre.
Der Grenzbereich. Dort, wo es um Dinge geht, die durch den Roman, das Theater nicht faßbar sind, wo der Film das einzige Medium ist, etwas zu erzählen. Ich will nicht einen Film zu schreiben, der, wenn man ihn einmal gesehen hat, damit erschöpft ist. Mich reizt der Film, den man öfter sehen und Dinge entdecken kann, die man vorher nicht bemerkt hat, die dann wieder einen neuen Sinn ergeben. Ich suche für meine eigene Arbeit den Film, der noch in 10, 15, 20 Jahren gespielt werden kann, durch die Thematik, durch die Form oder was immer. Ich bin weit davon entfernt, sogenannte moderne Formen zu suchen oder zu wollen, oder dem Mainstream zu gehorchen, das ist mir ein Greuel schlechthin.
Bei "Jedermanns Fest" hat es durch einen Streit zwischen dem Produzenten und Ihnen zweieinhalb Jahre Drehpause gegeben, wo's eigentlich "nur" darum ging, das Drehbuch 1:1 zu verfilmen... Nicht unbedingt 1:1. Wir haben damals, im Dezember 96, in einer Situation unterbrochen, in der ein Viertel des Drehbuchs überhaupt noch nicht verfilmt war. Ursprünglich hat die Produktion gesagt, wir würden drei Monate später weiterdrehen, und das wurde dem Team auch offiziell mitgeteilt, dann hat's geheißen, na ja, wir haben kein Geld, wir brauchen eh nix mehr drehen, man soll aus dem vorhandenen Material einen Film schneiden. Das halte ich für kriminell... Das heißt, nicht nur der gesamte Jenseits-Bereich mit Maria und Jurek, sondern auch der Unfall und der Schluß mit Sophie waren noch nicht gedreht, und nach Ansicht des Produzenten hätte das genügt, um einen Film draus zu schneiden. Den hätte man aber wegwerfen können, weil er keinen Sinn ergibt, weil er wesentlicher Dinge beraubt worden wäre. Der Produktion wär's egal gewesen, weil das Hauptziel ist ja Subventionen zu kassieren und was mit dem Film passiert ist wirklich sekundär. Das ist die Krankheit des deutschsprachigen und österreichischen Films. Es wird alles aufgewendet, um zu drehen, natürlich weil da Geld fließt, das man dann dazu verwendet, daß Firmen am Leben erhalten werden und die Branche scheinbar existiert. Das, was letztendlich mit den Filmen passiert, ist sehr bezeichnend, daß nämlich Verwertung oder Verleih, Auswertung, Betreuung oder Pflege eines Films kaum stattfindet. Viele, auch gute Filme, landen dann irgendwo und kommen kaum noch ans Licht. Bei manchen ist es ganz gut so, aber manche sind unverdient in der Schublade. Und dieses Denken nur bis zur Premiere ist ein tödliches. Der amerikanische Film ist uns in dieser Hinsicht weit überlegen. Nicht, daß sie jetzt bessere Filme machen – ich halte den europäischen Film für unvergleichlich interessanter– aber sie sind uns millionenfach überlegen im Bereich des Verwertens. Da könnten wir von ihnen lernen.
Rein logistisch, wie war die Drehzeit geplant? Ursprünglich auf elf Wochen, wir haben dann zwölf Wochen im Herbst 1996 gedreht, und waren aus verschiedenen Gründen noch immer nicht fertig. Dafür bin sicher auch ich verantwortlich, dazu hab ich mich immer bekannt, aber auch natürlich in ganz großem Ausmaß die Produktion, die geglaubt hat, das ganze würde schon irgendwie gehen, und dann hab ich aus dem noch zu drehenden Viertel ein "Notprogramm" gemacht mit einem Zeitraum von drei Drehwochen. Und diese drei Drehwochen haben wir fast zweieinhalb Jahre danach, im Frühling 1999, realisiert. Es gab also für diese Drehzeit eine neue neutrale Herstellungsleitung, einen neuen Produktionsleiter, das war der Auftrag der Geldgeber. Es war eine phantastische Drehzeit. In Zusammenarbeit mit diesem neuen Produktionsteam haben wir in diesen drei Wochen, vollkommen im Budget bleibend, in der Drehzeit bleibend, trotz Wetterproblemen, die ganze Sache realisiert.
Sprechen Sie mit dem Produzenten noch? Ja, wir geben uns die Hand. Ich hoffe sehr, daß jetzt das Gelingen des Films dazu beiträgt, daß er wieder in das Boot kommt, in dem er als Produzent sein müßte. Vielleicht wird’s auch eine Situation, wo man kaum noch miteinander spricht, vielleicht wird’s wieder Gespräche geben. Das ist in der Filmbranche oft wie in Beziehungen, daß Leute sehr gerne zusammen waren, dann haben sie sich in die Haare gekriegt, haben sich getrennt, und nach fünf Jahren treffen sie einander wieder und sind wieder ein Herz und eine Seele. Ich kann mir das im Augenblick überhaupt nicht vorstellen, aber auch bei Liebschaften kann man sich nicht vorstellen mit einem Partner, von dem man sich enttäuscht fühlt, wieder einmal zusammen zu sein. Trotzdem kann man es nicht ausschließen.
Sie haben jetzt zweieinhalb Jahre Drehpause gehabt. Ganz profan gefragt, was macht man in der Zwischenzeit? Ich war voll damit beschäftigt, alles zu unternehmen, um die Fortsetzung der Dreharbeiten zu ermöglichen. Ich hab zwei Jahre hindurch etwa 500 Seiten Briefe geschrieben, habe zwei Rechtsanwälte gehabt, die mir geholfen haben. Ich hab vorher nie mit Gerichten oder Rechtsanwälten zu tun gehabt, jetzt in vollem Ausmaß. Ich hab wegen meiner nicht bezahlten Gehälter prozessiert, und hab danach alles eingeleitet, um den Urheberrechtsprozeß zu gewinnen. Der Produzent hat gesagt, wenn ich nicht bereit bin, meinen Film, von dem ein Viertel noch nicht gedreht ist, mit dem vorhandenen Material fertigzustellen, dann wird er das machen. Damit war die Voraussetzung gegeben, daß er als Produzent in ein Drehbuch eingreift, von dem er von sich aus erklärt, ein Viertel zu kürzen. Er hat danach – ohne mein Wissen – auch noch zwei Drehtage gemacht, so Pseudodrehs, und das war für mich der Grund, ihn zu klagen. Und zum Prozeß ist es deswegen nicht gekommen, weil er gemerkt hat, daß er verlieren wird, und dann haben sich die Geldgeber bereit erklärt, Geld zu investieren, und das war die Voraussetzung – und da muß man den Geldgebern auch sehr dankbar sein – daß dann alles, was unabdingbar war, gedreht werden konnte. Jetzt ist der Film in Berlin und wird dort geschnitten. Ich pendle jetzt immer hin und her, der Film wird auch – wie es von Drehbeginn an geplant war – in den Babelsberg Studios zur Gänze synchronisiert, er bekommt einen Vollsynchronton, so wie "Schubert" auch.
Ja. Mit den 20%, die weggelassen sind, gekürzt oder anders gemacht wurden. 70 bis 80% sind da, manches ist schwächer geworden als im Drehbuch, das werde ich auch entsprechend im Schnitt berücksichtigen, kürzen und verknappen, und manches ist besser geworden. Es hält das Maß, in dem ich mich immer bewegt habe. Die Traurigkeit darüber, was man nicht geschafft hat, wird ein bißchen wettgemacht über die Zufriedenheit über das, was besser geworden ist.
Das wird nach wie vor von dem Produzenten, Martin Rosen, betrieben. Er hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, daß er bereits insgesamt 500.000 Dollar in das Projekt investiert hat, das sind 6 Millionen Schilling. Das steht einem Projekt dieser Größenordnung auch zu. Unser Übereinkommen ist das: entweder machen wir es so wie geschrieben, mit der entsprechenden Größe einer Figur wie Friedrich, oder überhaupt nicht. Das Geld, das dafür notwendig ist, ist einfach so viel, daß niemand sagen kann, ob der Film realisiert werden wird oder nicht.
Wie hoch ist er etwa kalkuliert? Das ändert sich immer. Ich kann mir vorstellen, im untersten Bereich sind es etwa 300 Millionen Schilling. Das ist eher Selbstbetrug, weil damit wird man nicht auskommen.
Sie haben 13 Jahre lang keinen Film gedreht. Konnten Sie von den Drehbuchaufträgen leben? Ja. Dadurch, daß ich in dieser Zeit Drehbücher geschrieben habe, die hochdotiert waren, eben in Verbindung mit dieser amerikanischen Produktion, aber auch weiteren gut bezahlten Drehbüchern, so wie es der Funktion des Drehbuchautors auch zusteht. Ich glaube überhaupt, daß ein gigantisches Mißverhältnis besteht in der Bezahlung der Leute, die Filme machen. Ich halte den Drehbuchautor für den am weitesten Unterbezahlten. Das ist höchst ungerecht, denn wenn er nicht ein Buch schreibt, das gut ist, entsteht auch kein guter Film. Ich halte Schauspieler für weit überbezahlt, ich halte Regisseure manchmal für halbwegs ausreichend bezahlt. Das heißt, die Honorare für Drehbuchautoren müssen gewaltig angehoben werden, ich würde sagen, verfünft bis verzehnfacht, damit dieser Beruf, der für gute Filme unabdingbar ist, auch höher bewertet wird. Da ist vieles nachzuholen. Ich hab davon leben können, indem ich meine monatlichen Kosten überschaubar gehalten habe und nichts ins Gigantische laufen ließ. Das heißt, ich konnte mich einigermaßen einschränken. Es ist aber nie eine Einschränkung gewesen, die ich negativ erlebt habe, sondern ein Luxus, den ich jetzt seit 25 Jahren oder noch länger pflege, nämlich bisher nie auch nur eine Zeile geschrieben oder einen Kader gedreht zu haben, den ich nicht auch gerne gedreht hätte, wenn ich nichts dafür bekommen hätte. Ich hab noch nie fürs Geld allein einen Handgriff getan, was Film betrifft. Diesen Luxus möchte ich mir behalten.
Schreiben Sie im Moment an etwas? Ich habe einige Projekte, aber ich schreibe im Moment nicht. Ich bin jetzt mit dem Schnitt beschäftigt. Ich bin immer sehr monogam, das ist auch ein Nachteil. Das heißt, ich arbeite nicht parallel an zwei, drei anderen Dingen, sondern mache nur die eine Sache. Wenn ich jetzt am Schnitt von "Jedermanns Fest" arbeite, habe ich natürlich immer wieder Gedanken an andere Projekte, die sich auf diese Weise halt langsam entwickeln. Aber es ist nie so, daß ich parallel an einem anderen Drehbuch schreibe, habe ich noch nie gemacht. Das hat den großen Nachteil, daß, wenn ein Film fertig war, ich dagestanden bin und kein neues Projekt hatte.
Wie lange wird der Schnitt dauern? Dann
wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und danke für das Gespräch.
(Quelle: Egon Netenjakob, TV-Filmlexikon) Inhaltsverzeichnis
|