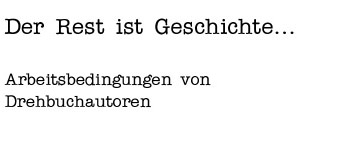
DIALOGE
SCHREIBEN
Geschichtlicher Abriß des
Dialogs in Filmen
Wenn man die Geschichte des Drehbuchschreibens
genauer betrachtet, gab es mit der Einführung des Tonfilms eine
Zäsur. Der Autor verstand sich vor 1930 eher als Bildermaler und
Beschreiber, nicht einmal die Zwischentexte oblagen den Autoren.
René Clair schrieb 1925: "Ein Film ist von dem Augenblick an
"rein", sobald er ausschließlich visuelle Wirkungen auf
den Zuschauer hat [...] Das Literarische eines Scenarios ist auf
jeden Fall zu vermeiden."1 Und Fernand
Léger bemerkte im gleichen Jahr: "Der Irrtum des Kinos ist
das Drehbuch"2 Diese Bemerkung ist vielleicht
darauf zurückzuführen, daß das Drehbuch zu Beginn der Filmgeschichte
nicht unbedingt fester Bestandteil in der Filmherstellung war. Bis
1926 gab es zum Beispiel in amerikanischen Filmen keine Credits
für Drehbuchautoren: Es gab zwar Gagschreiber, Treatmentautoren,
Szenaristen, Zwischentitel-Texter, etc., die jedoch für ein Butterbrot
ihre Texte für die noch junge Filmindustrie ablieferten.3
Mit der Einführung des Tonfilms (1929) waren plötzlich gute Dialogschreiber
gefragt. Während heutzutage manche Drehbuchautoren meinen, die wahre
Kunst des Drehbuchschreiben liege in den Dialogen, so muß man doch
feststellen, daß eine expressive Bildsprache eines Carl Mayer, z.B.
in Das Cabinet des Doktor Caligari (D, 1919, Regie: Robert
Wiene), bis heute unerreichbar geblieben ist. Mayer erlitt das bedauernswerte
Schicksal, nicht mehr den Anschluß an den Tonfilm gefunden zu haben.
Und mit ihm viele, viele andere Stummfilmautoren. Noch vor der Einführung
des Tonfilms wurde das Drehbuch, wie Béla Balász schreibt, "zur
literarischen Kunstform, und zwar, als der Film sich von der Literatur
befreite, als er, selbständig geworden, eigene visuelle Wirkungen
anstrebte."4 Der Tonfilm brachte aber
sofort einen visuellen Verlustfür den Film, die bildmalerische Qualität
von Drehbüchern war nicht mehr gefragt.
Zu Beginn der neuen Technologie war
man sich auch uneinig, welche sprachliche Herangehensweise der Filmautor
wählen sollte. Bela Balázs erschienen Laut und Klangfarbe –
und nicht etwa Gespräch und Dialog – bei der Gestaltung der
sprachlichen Artikulation am interessantesten. In seiner zweiten,
eigentlich dem Tonfilm zugeneigten Filmtheorie Der Geist des
Films (1930) konstatiert er: "Der Ton des Menschen ist
im Film interessanter als das, was er sagt. Auch beim Dialog wird
der akustisch-sinnliche Eindruck ausschlaggebend sein, nicht das
Inhaltliche"5. Schon präziser drückte
es Rudolf Arnheim aus, der von Beginn an skeptisch war, daß Ton
und vor allem Sprache ein künstlerisches Element des Films sein
könnte. In seiner Theorie Film als Kunst (1932) spricht er
davon, daß die "Filmsprache lebensnäher sein müsse" als
etwa die Bühnensprache. "Weder durch schöne Geschliffenheit
und Geschlossenheit der Wortfolgen noch auch durch ein getragenes
Deklamieren, wird sie sich als etwas Künstliches zu erkennen geben
dürfen, wenn sie nicht als ein isolierter Fremdkörper in ihrer Welt
stehen will, sondern der Tonfilm wird die oft unpräzise, fetzenhafte
Sprache des Alltags bringen"6.
Einige Filmkünstler haben tatsächlich
schon von Beginn den Ton von der Dialektik befreit und als kontrapunktisches,
künstlerisches Element benutzt. In Chaplins erstem Tonfilm City
Lights (1930) hört man kein einziges Wort. Einer hält eine Rede,
aber aus seinem Mund kommen nur unartikulierte Laute, ein quäkendes
Getön – Parodie auf die Inhaltlosigkeit so vieler Reden. Auch
René Clair ließ in seinem ersten Tonfilm Sous les Toits de Paris
(1930) hauptsächlich Geräusche und Laute vorherrschen, der Dialog
tritt zurück. In den meisten anderen Filmen der frühen Tonfilmzeit
erkennt man das Bemühen, daß Dialog nun plötzlich die Handlung transportieren
soll.
Heute erfüllen Dolby-Surround-Sound-Effekte die Funktion der "filmischen
Lautmalerei". In TV-Filmen fungiert Dialog primär als Informationsübermittlung,
paßt sich genau Situation und Figur an. Die Kunst des Dialogschreibens
ist eigentlich das Unausgesprochene, die Emotion: Über eine Schwierigkeit
zwischen geschriebenem Dialog und dessen Realisierung weist der
junge österreichische Regisseur Götz Spielmann hin. "Oft sind
gerade die Dialoge, die sich blendend lesen, die schlechten. Die
Konzentration, das Bewußtsein des Lesenden ist ein anderes als das
des Schauenden", und weist damit auf eine grundsätzliche Schwierigkeit
zwischen Autor und Regisseur hin: "Im Film stürzt dann alle
Spannung ab, denn die Bilder können mit diesem blendenden Dialog
nichts anderes tun, als ihn zu illustrieren. Und die Augen des Zuschauers
sind, anders als die Fantasie des Lesenden, so nicht befriedigbar.
Sie bekommen keine Geschichte erzählt, denn diese ist zu hören."
7
Es ist vielleicht eine Anmerkung wert,
daß sich im Film technisch in kurzer Zeit sehr viel verändert hat,
ebenso gibt es heutzutage – und das sogar im Mainstream-Kino
– das Bemühen, neue Erzählformen zu versuchen, in puncto Dialog
allerdings hat es in den letzten Jahrzehnten überhaupt keine Weiterentwicklung
gegeben. Vielleicht war die letzte große Innovation der innere Monolog,
wie er erstmals in Orson Welles‘ Citizen Kane eingesetzt
wurde. Es folgten Kunstfilme, die diesen Off-Text als literarisches
Stilmittel benutzten (Resnais Filme Letztes Jahr in Marienbad
oder Hiroshima mon amour), dann der sparsame, reportagenhafte
Monolog in den Filmen des cinéma vérité. Der kontrapunktische
Monolog der Satire, wie er schon früh in dem englischen Film Adel
verpflichtet (GB 1949 / R.: Robert Hamer) mit dem staubtrockenen,
humorvollen Kommentaren von Alec Guiness eingesetzt wurde, findet
sich durchaus erfolgreich im modernen Hollywood-Kino wieder - in
Filmen wie Forrest Gump und American Beauty.
Problemfeld "österreichische"
Dialoge
Ein spezifisch österreichisches Problem
seit der Einführung des Tonfilms ist das bewußte Ausklammern des
österreichischen Dialekts in vielen Filmen, respektive das Vorhandensein
eines künstlichen "Österreichischen", das nirgendwo in
Wirklichkeit gesprochen wird. "Es ist das Wienerische/Österreichische,
wie es sich die Deutschen vorstellen – und sie stellen es sich
so vor, weil es ihnen in einem fort so vorgespielt wird – es
ist, um einen Filmtitel zu bemühen, ein circuito chiuso zu diagnostizieren.",
schreibt der Autor und Filmpublizist Georg Schmid.8
Gerade in den letzten Jahren ist es
in heimischen Produktionen wieder verstärkt zu einer Germanisierung
und "Wenzellüddeckisierung" der Sprache gekommen. Keiner
von den drei in dieser Arbeit befragten österreichischen Autoren
hat angegeben, diesen Kompromiß eingehen zu wollen. Bei Ernst Hinterberger
versteht es sich von selbst, seine Stoffe spielen ausschließlich
in Wien. Allerdings schreibt er die Dialoge nicht im Dialekt. Dies
hat sicher mit einer besseren Lesbarkeit, aber auch mit dem Vertrauen,
daß der Schauspieler den Dialog im Dialekt sprechen wird, zu tun.
Die Vulgarität, die dem Autor dabei oft vorgeworfen wird, bezieht
er aus dem alltäglichen Wiener Sprachduktus: "Wenn man [in
Wien] einen trifft und sagt ‚Servus, du alter Hurenbangel‘
meint man ja damit nicht, daß dessen Mutter am Strich gegangen ist,
das ist eine Redewendung."
Für Fritz Lehner, der einerseits mit
Laien arbeitete und deren Sprache in keiner Weise einschränkte,
andererseits Drehbücher schrieb, die nach der Hochsprache verlangten,
ist es ein Greuel in österreichischen Filmen bundesdeutsche Ausdrücke
zu finden: "Alles wird genormt nach einer Sprache, von der
man meint, sie müßte wirklich deutsch sein. Das Deutsche,
das in Deutschland gesprochen wird, ist ja voller Fehler, ist voll
Unbeholfenheiten, gehört zum Dümmsten überhaupt, wie man Deutsch
sprechen kann."(Interview) Nicht nur Lehner, sondern auch Barbara
Albert, ist es gelungen, sich gegen deutsche Co-Produktionspartner
(bei Lehners Schöne Tage der Sender Freies Berlin, bei Alberts
Nordrand das ZDF) durchzusetzen und den jeweils regionalen
Dialekt in ihren Filmen beizubehalten. Allerdings: beide Sender
waren nicht federführend an den Projekten beteiligt.
Ganz anders stellt es sich dar, wenn der deutsche Partner mehr Geld
im Spiel hat. Und mehr Macht. Es ist eine österreichische Angewohnheit,
dem Druck aus Deutschland freiwillig nachzugeben und vorauseilend
Gehorsam zu leisten. Die Tradition dieser Anbiederung läßt die Erinnerung
an dunkle Zeiten wach werden. Schon zwischen 1934 bis 1938 bemühte
man sich redlichst, die "Entjudung" der österreichischen
Filmindustrie durchzuführen. Und auch sprachlich wollte man von
den Deutschen "verstanden" werden. Der Volksschauspieler
Paul Hörbiger bekannte sich auch nach dem Krieg noch zur sprachlichen
Assimilation: "Aufgrund meiner reichen Erfahrungen, die ich
während meiner Dreharbeiten in Deutschland sammeln konnte, habe
ich mir einen Wiener Dialekt zugelegt, der auch in Berlin und Hamburg
verständlich ist." 9
Seltsamerweise gelingen auch heute
trotz sprachlicher Anpassung kaum österreichische Filme, die in
Deutschland reüssieren können. Danach sind alle erstaunt und können
es sich nicht erklären. Vielleicht bekommt man eine Antwort, indem
man sich die umgekehrte Situation ansieht. Denn auch die deutschen
Filme sind, bis auf wenige Ausnahmen, und obwohl sie sprachlich
hier bestens verstanden werden, in Österreich alles andere als erfolgreich.
In Wirklichkeit kommt auch nur ein verschwindend geringer Prozentsatz
der deutschen Kinoproduktionen in unsere Filmtheater, also kann
die Sprache allein nicht der einzige "unüberwindbare Gegensatz"
sein.
Problemfeld Synchronizität
Ein Problem, das beim Schreiben von
Dialogen auftreten kann, das spätestens beim Auflösen und Inszenieren
akut wird, ist die Tatsache, daß es ja nicht nur Dialoge zwischen
zwei Menschen, sondern auch zwischen drei, vier oder vielen Figuren
gibt. Das erste Problem beim Schreiben ist, in welcher Form die
gleichzeitig laufenden Dialoge, wie sie zum Beispiel in einem Restaurant
vor sich gehen, zu Papier zu bringen sind. In der Prosa hat man
ja das schöne Wort "während", um auf synchron laufende
Handlungen hinzuweisen. Dem Drehbuch, als streng chronologisch aufgebautes
Szenenprotokoll, nützt dies nichts. Der Autor kann nun alle Dialoge,
auch die aus dem hintersten Off-Winkel in sein Drehbuch aufnehmen,
und zum Beispiel nebeneinander aufschreiben, was sicherlich die
Lesbarkeit einer Szene erschwert, oder er entscheidet sich, die
Figuren nur peripher in der Szene anzuführen und eine Beschreibung
wie "Gesprächsfetzen vom Nebentisch sind zu hören" zu
schreiben. Der Nachteil an der peripheren Beschreibung ist sicherlich,
daß sich der Regisseur die "Vorstellung" des Autors eben
nicht vorstellen kann, und diesen kleinen Nebensatz für so unwichtig
hält, daß die Szene plötzlich nicht mehr in einem belebten Restaurant,
sondern an einem einsamen Würstlstandl spielt. Wie auch immer, Dialoge
zwischen mehr als drei Personen bringen selbst große Könner des
Regiefachs in Schwierigkeiten. Im Theater ist die Sache einfach,
im Film ist es eine große Kunst, Szenen von einer sprechenden Masse
gut zu inszenieren. Bei einem Gespräch zwischen acht Personen die
richtigen Achsen im Kopf zu behalten, die unterschiedliche Sprache
und Lautstärke der Beteiligten zu berücksichtigen und dies alles
in eine umfassende Choreographie zu fassen, ist keine leichte Aufgabe.
Vor allem, wenn man auf diese Weise Pointen transportieren will.
Sollte der österreichische Drehbuchautor merken, daß der Regisseur
bei solchen Szenen nicht sattelfest ist, sollte er sie schleunigst
reduzieren oder ganz weglassen. Eines der wenigen, gelungenen Beispielen
der jüngsten Zeit war der dänische Film Das Fest (1998, Regie
& Buch: Thomas Winterberg), auch alle Bergman-Filme geben Nachhilfe
in guter Dialog-Auflösung. So gesehen wären heimische Dialogmeister
in Skandinavien besser aufgehoben.
Fußnoten:
1
René Clair: Cinéma pur et cinéma commercial. In: Les Cahiers du
Mois, No 16/17 ("Cinema"), 1925, S.90
2 Fernand Léger:
Der Irrtum ist das Drehbuch" In: Les Cahiers du Mois, No 16/17
("Cinema"), 1925
3 Pat McGilligan
[Hg.]: Backstory 1, Interviews with Screenwriters of the Golden
Age, Berkely 1991, S.1
4 Béla Balasz:
Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst. Wien 1949, S.230
5 Balázs, Béla:
Das Tonfilm-Manuskript. In: Film-Kurier v. 1.6.1929, In: Béla Balázs:
Schriften, Bd. 2, S.252f.
6 Arnheim, Rudolf:
Film als Kunst (1932). Frankfurt 1979, S.240f.
7 Götz Spielmann,
in: Gustav Ernst (Hg.): Sprache im Film, Wien 1994, S.111
8 Georg Schmid:
Der österreichische Film existiert nicht, in: Ruth Beckermann/Christa
Blümlinger [Hg.]:Ohne Untertitel. Fragmente einer Geschichte des
österreichischen Kinos, Wien 1996, S.162
9 W.Höfig: Der
deutsche Heimatfilm 1947-1960. Stuttgart 1973, S.73, In: Walter
Fritz: Kino in Österreich 1945-1983, Wien 1984, S.111
Inhaltsverzeichnis Homepage
Homepage
|